Interdisziplinäre institutionelle Kontexte
Die Religionswissenschaft ist in Göttingen interdisziplinär eingebettet. Ihre räumliche Unterbringung im Gebäude der Theologischen Fakultät entspricht der organisatorischen Verortung der Religionswissenschaft mit ihrem Fachpersonal in dieser Fakultät (homepage). Zugleich wird von hier aus jedoch der Studiengang in Religionwissenschaft betreut, der in der Philosophischen Fakultät angesiedelt ist. Die fest angestellten FachvertreterInnen sind daher meist Doppelmitglieder in beiden Fakultäten. Ähnliche interdisziplinäre Verankerungen des Fachs finden sich weltweit an vielen Universitäten. In der religionswissenschaftlichen Forschung und Lehre kooperieren daher auch meist VertreterInnen sozialwissenschaftlicher, geistes- und kulturwissenschaftlicher und theologischer Forschungsdisziplinen. Ihr gemeinsames Interesse gilt dabei trotz unterschiedlicher Einzelfachperspektiven und verschiedener methodischer Ansätze jeweils der Religionsthematik. Die Religionswissenschaft ist nämlich angesichts ihres umfangreichen Gegenstandsbereichs "Religion" bzw. "Religionen" notwendig auf interdisziplinäre Kooperationen angewiesen. In den neu eingeführten BA/MA-Studiengängen in Religionswissenschaft kommt dies in den jeweiligen "Wahlmodulen" besonders deutlich zum Ausdruck, die aus verschiedenen Fachdisziplinen (Indologie, Islamwissenschaft, Judaistik, Theologie, etc.) "importiert" wurden. Auch im herkömmlichen Magisterstudiengang können religionsbezogene Lehrveranstaltungen aus anderen Fachwissenschaften auf die Semesterwochenstunden angerechnet werden.
Durch die Doppelfachstruktur in allen Studiengängen ist die Klientel der Studierenden mit ihren unterschiedlichen Fächerkombinationen ebenfalls interdisziplinär gemischt: 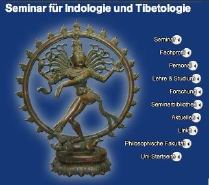 in den Lehrveranstaltungen treffen meist Studierende mit unterschiedlichen ethnologischen, soziologischen, historischen oder philologischen Ausbildungs- und Schwerpunktkenntnissen zusammen, und diese Mischung bereichtert die Diskussion religionswissenschaftlicher Themen erheblich, denn auf diese Weise lernt man neue Einblicke in andere methodische Perspektiven oder wichtige Informationen auf dem Hintergrund anderer fachwissenschaftlicher Sprach- und Feldkompetenzen kennen. Diese interdisziplinäre Herausforderung und Bereicherung setzt sich auf der Ebene der graduierten und postgraduierten Forschungstätigkeit vertieft fort: Oft sind für ein Dissertationsprojekt speziellere Methoden der empirischen Sozialforschung oder philologische Kenntnisse in bestimmten Sprachen nachzuarbeiten, die wieder mit neuen Fachperspektiven konfrontieren und dadurch den Horizont erweitern.
in den Lehrveranstaltungen treffen meist Studierende mit unterschiedlichen ethnologischen, soziologischen, historischen oder philologischen Ausbildungs- und Schwerpunktkenntnissen zusammen, und diese Mischung bereichtert die Diskussion religionswissenschaftlicher Themen erheblich, denn auf diese Weise lernt man neue Einblicke in andere methodische Perspektiven oder wichtige Informationen auf dem Hintergrund anderer fachwissenschaftlicher Sprach- und Feldkompetenzen kennen. Diese interdisziplinäre Herausforderung und Bereicherung setzt sich auf der Ebene der graduierten und postgraduierten Forschungstätigkeit vertieft fort: Oft sind für ein Dissertationsprojekt speziellere Methoden der empirischen Sozialforschung oder philologische Kenntnisse in bestimmten Sprachen nachzuarbeiten, die wieder mit neuen Fachperspektiven konfrontieren und dadurch den Horizont erweitern.
Bewährt haben sich Fächerkombinationen zwischen Religionswissenschaft und Indologie, Ethnologie, Kulturanthropologie, Geschichte, Islamwissenschaft, Ägyptologie, Sozialwissenschaften u.ä. – Neben den buchstäblich "nahe liegenden" Bibliotheken der zentralen Unviersitätsbibliothek und der religionswissenschaftlichen Fachbibliothek (im Theologicum) bietet das umfassende Fächerangebot der Universität Göttingen eine hervorragende Infrastruktur mit vielen Spezialbibliotheken an den Instituten der Arabistik/Islamwissenschaft, Indologie, Ethnologie, Soziologie usw.,  mit deren Hilfe auch speziellen Fragestellungen in der jeweils relevanten Fachliteratur nachgegangen werden kann. Die traditionsreiche und deutschlandweit bemerkenswerte "Völkerkundliche Sammlung" am Institut für Ethnologie ist ein weiteres Highlight. – Das breite Fächerangebot der Universität Göttingen und die dazugehörige Infrastruktur ermöglichen daher auch ganz eigenständig angepasste Studien- und Forschungsschwerpunkte mit jeweils entsprechend individuell zugeschnittenen Berufsmöglichkeiten.
mit deren Hilfe auch speziellen Fragestellungen in der jeweils relevanten Fachliteratur nachgegangen werden kann. Die traditionsreiche und deutschlandweit bemerkenswerte "Völkerkundliche Sammlung" am Institut für Ethnologie ist ein weiteres Highlight. – Das breite Fächerangebot der Universität Göttingen und die dazugehörige Infrastruktur ermöglichen daher auch ganz eigenständig angepasste Studien- und Forschungsschwerpunkte mit jeweils entsprechend individuell zugeschnittenen Berufsmöglichkeiten.
